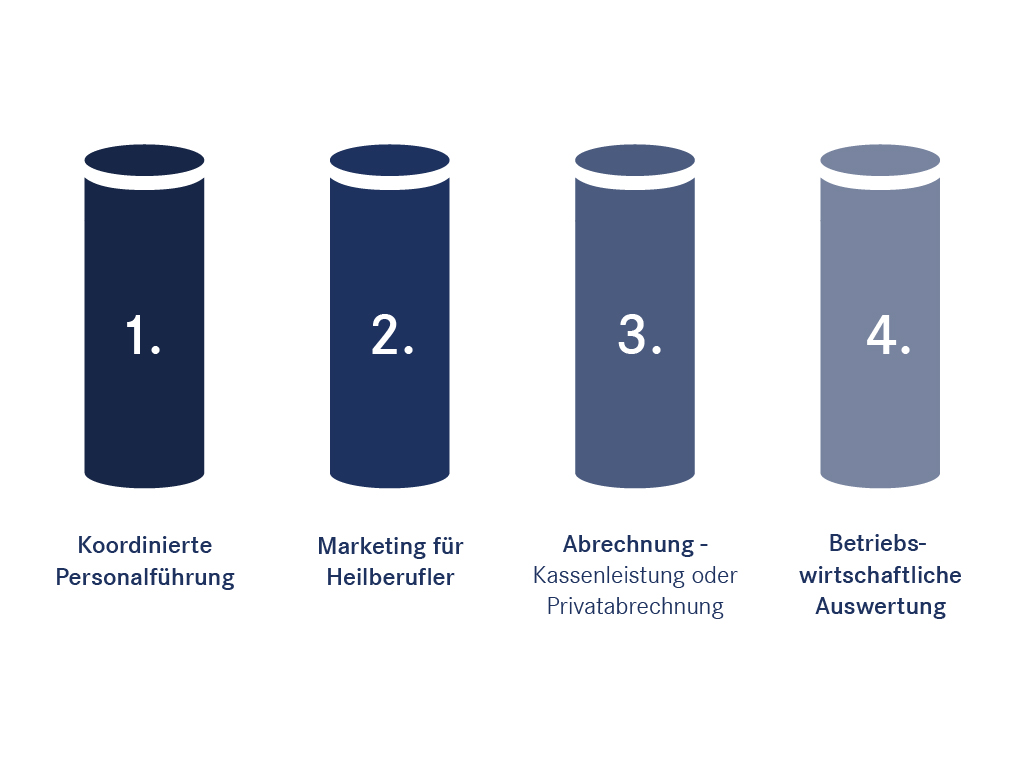Von A wie Apparategemeinschaft - bis Z wie Zweigpraxis

Formen der Niederlassung
Niederlassungsformen für Gründer
Eine Übersicht der Rechtsformen
Neben der vollen Zulassung und der typischen Praxisform der Einzelpraxis gibt es weitere Möglichkeiten, seinen Beruf nach eigenen Vorstellungen auszuüben.
Welche Niederlassungformen gibt es?
Für die Gründung ist eine Genehmigung durch den Zulassungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) erforderlich.
Ein großer Vorteil für die Kooperationspartner liegt in der gemeinsamen Nutzung von Personal, Räumen und Geräten. Zudem behandeln sie einen gemeinsamen Patientenstamm und rechnen ihre Leistungen über eine einheitliche Betriebsstättennummer gegenüber der KV ab.
Die Gewinnverteilung erfolgt entsprechend den Regelungen des vereinbarten Gesellschaftervertrags.
Die ÜBAG stellt eine Sonderform der BAG dar, bei der die gemeinsame ärztliche Tätigkeit an mehreren räumlich getrennten Betriebsstätten ausgeübt wird. Die Partner legen einen Praxissitz als Hauptbetriebsstätte fest und definieren die weiteren Praxissitze als Nebenbetriebsstätten. Voraussetzung ist, dass an jedem Praxissitz mindestens ein Partner hauptberuflich tätig ist.
Die ÜBAG bietet erhebliche Vorteile:
- Partner können entweder ausschließlich an ihrem eigenen Praxissitz arbeiten oder wechselseitig auch an den Standorten der anderen Partner praktizieren.
- Zudem ist eine ÜBAG sowohl innerhalb einer KV-Region als auch KV-übergreifend zulässig, wobei eine Genehmigung des Zulassungsausschusses der KV erforderlich ist.
- Ein weiterer Vorteil liegt in der gemeinsamen Außendarstellung, die zu einer besseren Wahrnehmung der Praxis führt und die Patientenbindung stärkt.
Die Teil-BAG ist typischerweise überörtlich und eignet sich besonders, wenn bestimmte Krankheitsbilder fachübergreifend behandelt werden sollen und nur einzelne Patienten gemeinsam versorgt werden. Dabei behalten die Partner ihre eigenen Praxissitze bei, praktizieren jedoch zusätzlich am Standort des Partners.
Beispiel:
Ein Kinderarzt und ein Orthopäde könnten beispielsweise an einem Wochentag gemeinsam eine Sprechstunde anbieten, während sie an den übrigen Tagen ihre Patienten unabhängig voneinander behandeln.
Eine Teil-BAG ist sowohl innerhalb einer KV-Region als auch KV-übergreifend erlaubt. Allerdings ist eine Genehmigung durch den Zulassungsausschuss der KV erforderlich.
Wichtig:
Die Teil-BAG darf nicht zur Umgehung des Zuweisungsverbots gegen Entgelt genutzt werden. Sowohl das Sozialrecht als auch die Berufsordnungen der Landesärztekammern untersagen Konstruktionen wie Kick-back- oder Provisionsmodelle in diesem Zusammenhang.
Die Ärzte behandeln einen gemeinsamen Patientenstamm und rechnen ihre erbrachten Leistungen gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) über eine Betriebsstättennummer ab. Die Gewinnverteilung erfolgt gemäß den Regelungen des vereinbarten Gesellschaftervertrags.
Gründer eines MVZ können zugelassene Ärzte, Krankenhäuser, Erbringer nichtärztlicher Dialyseleistungen, anerkannte Praxisnetze sowie zugelassene oder ermächtigte gemeinnützige Träger und Kommunen sein. Auch für ein MVZ ist eine Genehmigung durch den Zulassungsausschuss der KV erforderlich.
Der Jobsharing-Partner erhält eine Zulassung, die an die des Vertragsarztes gebunden und auf die Dauer der gemeinsamen Tätigkeit begrenzt ist. Dabei dürfen weder die Art noch der Umfang der Leistungen der bestehenden Praxis wesentlich verändert werden. Eine Leistungssteigerung im GKV-Bereich ist auf maximal drei Prozent des Fachgruppendurchschnitts begrenzt.
Dieses Modell wird häufig gewählt, um den Praxisinhaber zu entlasten und den Praxisnachfolger schrittweise in den Arbeitsalltag einzuführen.
Teilzulassung: langsamer Einstieg
Teilzulassung als zusätzliche Option
Mit der Teilzulassung hat der Gesetzgeber eine zusätzliche Niederlassungsoption für (Zahn-)Ärzte geschaffen. Voraussetzung ist, dass bestehende Vertrags(zahn-)ärzte ihren vollen Versorgungsauftrag reduzieren. Dieser kann auf einen halben Versorgungsauftrag beschränkt werden, während die andere Hälfte der Zulassung ausgeschrieben wird. Für Gründer, die nicht mit voller Arbeitsleistung starten können oder möchten, ist dies eine ideale Lösung.
Die 20 Wochenstunden Sprechzeit werden in zwei Einheiten à 10 Stunden aufgeteilt. Ebenso wird die Verpflichtung zur Teilnahme am organisierten Bereitschaftsdienst bei einer Teilzulassung entsprechend halbiert. Diese Regelung bietet optimale Bedingungen für einen flexiblen und durchdachten Einstieg in die Niederlassung.
Video "Existenzgründung: Welche Möglichkeiten bieten sich Ärzten?"
Gemeinsam heilen, gemeinschaftlich wirtschaften
Jede Praxis wird eigenständig geführt und rechnet ihre Leistungen gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) mit einer eigenen Betriebsstättennummer ab. Für vereinbarte Teilbereiche, in denen eine Zusammenarbeit erfolgt, wird eine Kostengemeinschaft in Form einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) gegründet.
Jeder Inhaber erzielt den Gewinn aus seiner eigenen Praxis und haftet für seinen Praxisbereich mit seinem Geschäfts- und Privatvermögen.
Die Nutzungskosten werden unter den Ärzten aufgeteilt.
Ein Ärztehaus bietet zahlreiche Vorteile:
- Patientinnen und Patienten erhalten eine fachlich umfassende und abgestimmte Versorgung.
- Die organisatorische Zusammenarbeit funktioniert reibungslos durch abgestimmte Raumkonzepte, Personalplanung und gemeinsame Gerätenutzung.
- Rechtlich bleiben alle Einrichtungen eigenständige Einheiten.
- Die Abrechnung gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) erfolgt über die jeweils eigene Betriebsstättennummer.
- In größeren Ärztehäusern wird die Verrechnung gemeinschaftlich erbrachter oder gegenseitig erbrachter Leistungen in der Regel durch eine eigens gegründete Betriebsgesellschaft organisiert und verwaltet.
Ziel des Zusammenschlusses in einem dezentralen, regionalen Verbund von niedergelassenen Haus- und Fachärzten sowie weiteren Anbietern aus dem ambulanten und/oder stationären Bereich ist die Verbesserung der Qualität und/oder Effizienz der Versorgung durch eine intensivierte fachliche Zusammenarbeit.
Einige Praxisnetze verstehen sich als Qualitätszirkel, die durch selbst auferlegte Zielvereinbarungen die Ergebnisqualität verbessern. Andere bieten ein gemeinsames Versorgungsangebot für Gesundheitsunternehmen an oder bilden Einkaufsgemeinschaften im Sinne einer Servicegesellschaft. Wieder andere legen ihren Schwerpunkt auf Vertragsverhandlungen und Honorarabrechnung.
Die ärztliche Tätigkeit am Hauptsitz muss die Tätigkeit an Nebenbetriebsstätten insgesamt überwiegen. Wichtig ist auch, dass durch die Gründung einer Zweigpraxis in der Regel kein zusätzliches KV-Budget für die Abrechnung der dort erbrachten Leistungen geschaffen wird. Eine Genehmigung durch den Zulassungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) ist erforderlich.
Neben niedergelassenen Haus- und Fachärzten können beispielsweise auch Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen oder Praxisnetze an der „IV“ teilnehmen. IV-Modelle eignen sich besonders für komplexe Behandlungsprozesse. Durch eine strukturierte und organisierte Behandlungsabfolge sollen sowohl die Versorgungsqualität als auch die Wirtschaftlichkeit der Versorgung verbessert werden.
Die Form und Höhe der Vergütung werden vertraglich zwischen den Teilnehmern festgelegt. Die Teilnahme an der IV ist sowohl für Leistungserbringer als auch für Versicherte freiwillig.